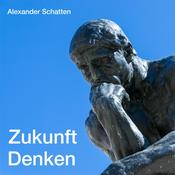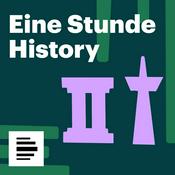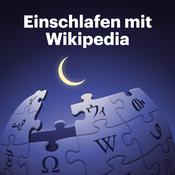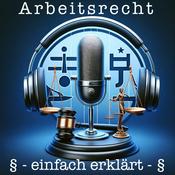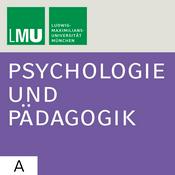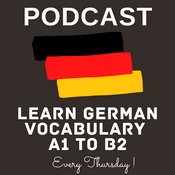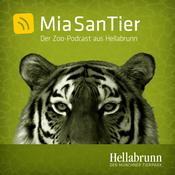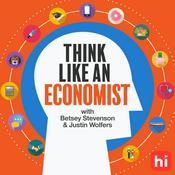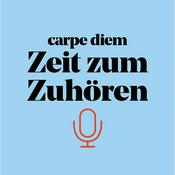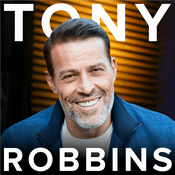147 Episoden
- Das ist heute ein Quickie, aber das Thema scheint mir so relevant, dass ich es kurz teilen möchte.
Außerdem möchte ich wieder mit ein paar Fragen zum Ende der Episode zum Nachdenken provozieren. Schicken Sie mir gerne Ihre Ideen dazu, auch gerne via X.
Die Kernfrage, die ich mir in der letzten Zeit in Diskussionen mit guten Journalisten immer wieder stelle ist: sind wir heute besser informiert als früher, also nehmen wir etwa als Vergleichszeitraum die 1960er Jahre an. Oder man sollte vielleicht noch etwas genauer formulieren: wer ist heute besser informiert als früher und wer vielleicht schlechter?
Auslöser war unter anderem ein Artikel von Ted Gioia, auf den ich kürzlich gestoßen bin, der sich im Kern auf einen Artikel einer Gruppe britischer Journalisten bezieht. Und was diese Journalisten herausgefunden haben, ist schon — selbst nach heutigen Maßstäben — abenteuerlich. Gioia schreibt
“There’s disturbing evidence that a growing number of experts cited in the media simply don’t exist. And they are showcased in some of the most prestigious newspapers and online platforms.A group of journalists recently tried to verify the existence of 50 experts featured more than a thousand times in prominent articles. But these people can’t be found in the real world. In many instances, the articles include a photo that appears to be AI-generated.”
und weiter:
It’s a lot easier to create these fake experts than to prove their non-existence.
Sind wir also besser oder schlechter informiert, und wer ist überhaupt »Wir«?
Weitere Zitate der Episode:
»Nullius in Verba!«, Motto der Royal Society
zurückgehend auf Horaz:
»Nullius addictus iurare in verba magistri.«
Hexenmeister oder Zauberlehrling? Die Wissensgesellschaft in der Krise
ist verfügbar! Zum Vertiefen in derartige Themen, sowie um dieses Projekt zu unterstützen!
Andere Episoden
Episode 143: Auf Sand gebaut?
Episode 138: Im Windschatten der Narrative, ein Gespräch mit Ralf M. Ruthardt
Episode 134: Das Werdende, das ewig wirkt und lebt? Transzendent oder Transient
Episode 133: Desinformiere Dich! Ein Gespräch mit Jakob Schirrmacher
Episode 130: Populismus und (Ordo)liberalismus, ein Gespräch mit Nils Hesse
Episode 121: Künstliche Unintelligenz
Episode 116: Science and Politics, A Conversation with Prof. Jessica Weinkle
Episode 112: Nullius in Verba — oder: Der Müll der Wissenschaft
Episode 106: Wissenschaft als Ersatzreligion? Ein Gespräch mit Manfred Glauninger
Episode 102: Live im MQ, Verantwortung. Ein Gespräch mit Daphne Hruby
Episode 93: Covid. Die unerklärliche Stille nach dem Sturm. Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann
Episode 84: (Epistemische) Krisen? Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann
Referenzen
Are These 50 Experts Real People? - by Ted Gioia
Noam Chomsky and Edward S. Herman, Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (1988)
Manufacturing Consent
S.J. Taylor, Stalin's Apologist: Walter Duranty, The New York Times's Man in Moscow, Oxford University Press (1990)
Doomberg, Fit to Print. One news event, many spins: A global propaganda tour. (2026)
Nullius in Verba — Royal Society - Wieder eine kurze Folge der Reflexion des vergangenen Jahres, die auch für mich selbst dient: Was habe ich gebracht, warum und wie soll ich in diesem Jahr weitermachen? Auch wenn dies bereits die zweite Folge im Jahr ist, aber das spielt ja wohl keine große Rolle.
Der Titel der Folge ist »Reflexion und Rekonstruktion« — der zweite Teil des Titels wird sich am Ende der Episode klären.
Mein neues Buch:
Hexenmeister oder Zauberlehrling? Die Wissensgesellschaft in der Krise
ist verfügbar!
Perfekt um die Reflexion des vergangenen Jahres zu vertiefen und zu verbreitern!
Interessant für mich ist im Rückblick aber immer: Was waren die Schwerpunkte? Warum diese Themen, was nehme ich weiter mit? Die Themen sind oft getrieben von meinen aktuellen Interessen und Recherchen, Vorträgen, kommerziellen Beratungen und Projekten.
Sie sind weniger getrieben — wie es sein sollte — von zeitgeistigen Themen, wenngleich das im vergangenen Jahr etwas anders ausgesehen haben mag, aber ich komme gleich darauf.
Begleiten Sie mich auf einer kurzen Reflexion, aber auch bei einem vielleicht etwas launigen Kommentar.
Die Zitate dieser Episode:
»Die Omnipräsenz der Krise, die zu einem Merkmal unseres Lebens geworden ist, stellt uns jedoch vor ein großes Problem: Die Krise ist die Unterbrechung des Alltags, nicht dessen Fortsetzung mit anderen Mitteln.«, Konrad Paul Liessmann
Liessman weiter in diesem Buch:
»Und in aller Krisenrhetorik wird meist der Fokus auf die vermeintliche Krise gelenkt, von der einige profitieren, während die wirklichen Krisen übersehen oder dadurch herbeigeführt werden.«
Nullius in Verba ist das Motto der ältesten wissenschaftlich Gesellschadt der Welt, der Royal Society, die 1660 gegründet wurde und übersetzt sich in etwa so ins Deutsche: »Verlass dich auf das Wort von niemandem«.
»unaccountability to the external world is not simply a happenstance but a principle«, Thomas Sowell
Dr. Daniel Stelter in Episode 144:
»Es ist einfach traurig. Wir sind einfach in jeder Hinsicht so viel schlechter geworden.«
Douglas Murray über das Zeitalter der Rekonstruktion:
»We should be the reconstructionists. The deconstructionists knew something about how to take things apart but like children with bicycles had no idea how to put them back together.«
und zum Abschluss:
»We have the choice either to live in the wastelands or to rebuild them.«
Referenzen
Konrad Paul Liessmann, Was nun? Eine Philosophie der Krise, Paul Zsolnay Verlag (2025)
Thomas Sowell, intellectuals and Society, Basic Books (2010)
Douglas Murray at ARC 2025: The Age of Reconstruction 144 — Was ist Fortschritt? Ein Gespräch mit Dr. Daniel Stelter aus ökonomischer Perspektive
14.1.2026 | 54 Min.Ich habe mich mit dem Thema »Fortschritt« — also was konstituiert Fortschritt in unserer Gesellschaft, wie können wir ihn beschreiben, wie wird Fortschritt kritisiert, wie unterscheidet sich Fortschritt von Innovation usw. — schon des Öfteren in diesem Podcast auseinandergesetzt. Dies ist im Kern eines der wichtigsten Themen, vielleicht sogar ein roter Faden, der durch die sechs Jahre des Podcasts läuft.
Mein neues Buch:
Hexenmeister oder Zauberlehrling? Die Wissensgesellschaft in der Krise
ist verfügbar! Schon gelesen?
In dieser Episode freue ich mich besonders, Ihnen meinen heutigen Gast vorstellen zu dürfen: Dr. Daniel Stelter. Er ist Ökonom und daher betrachten wir das Thema Fortschritt aus der Brille der Ökonomie.
Dr. Stelter ist nicht nur einer der führenden deutschen Ökonomen, er ist außerdem häufiger Gast in politischen Talkshows, schreibt regelmäßig für verschiedene Medien wie etwa die Wirtschaftswoche, Cicero, Handelsblatt und andere. Er ist Autor mehrerer Bücher und hat außerdem eigene Podcasts wie Beyond the Obvious und Make Economy Great Again, letzterer gemeinsam mit dem Herausgeber der Welt, Ulf Poschardt. Links dazu wie immer in den Shownotes.
Da er sich über seine Artikel sowie die eigenen Podcasts sehr ausführlich mit dem aktuellen Geschehen beschäftigt, werden wir in dieser Episode einen anderen Blickwinkel wählen.
Aber steigen wir gleich direkt in das Thema ein, sozusagen: keine Details — was ist Fortschritt?
»Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.«, Soren Kierkegaard
Wie aber gestalten wir unser Leben vorwärts? Dazu ergänzt Milan Kundera einen wichtigen Aspekt:
»Der Mensch schreitet im Nebel voran. Aber wenn er zurückblickt, um die Menschen der Vergangenheit zu beurteilen, sieht er keinen Nebel auf ihrem Weg. Von seiner Gegenwart aus, die ihre ferne Zukunft war, sieht ihr Weg für ihn völlig klar aus, gute Sicht auf dem ganzen Weg. Wenn er zurückblickt, sieht er den Weg, er sieht die Menschen, die voranschreiten, er sieht ihre Fehler, aber nicht den Nebel.«
In der Rückschau wirken die Dinge oftmals klar und einfach oder werden so dargestellt. Der richtige Pfad und die Irrtümer sind doch so offensichtlich! Was bedeutet das für die Ökonomie? Dr. Stelter erläutert dies am Beispiel von Geldmenge, Inflation und Zinsen.
Wie würden Ökonomen Fortschritt beschreiben, oder an welchen Indikatoren würden Sie Fortschritt festmachen?
»Es gibt eine ganz eindeutige Korrelation zwischen wachsendem Einkommen und zunehmendem Glück.«
Und wie ist es uns hier (global) in den vergangenen Jahren ergangen?
»Eigentlich, wenn man mal guckt: die letzten 20, 30 Jahre haben wir einen unglaublichen Zuwachs an Wohlstand gesehen — weltweit — wir haben einen Rekord-Rückgang der Armut. Das ist ein ganz großer Erfolg. Wir haben einen Rückgang der Kindersterblichkeit usw.«
Auch wenn es immer wieder Rückschritte gibt:
»Die Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte des Fortschritts.«
Wie ist Fortschritt zu beschreiben, vor allem auch gegen den Begriff der Innovation? Wer trifft die gesellschaftlich wichtige Bewertung? Außerdem: Was wird eigentlich von den Menschen als »Neu« wahrgenommen?
»Es gibt keinen Fall in der Weltgeschichte, wo geringerer Wohlstand zu mehr Glücksgefühl geführt hat.«
Was aber ist schlicht »Hintergrund«, Normalität?
»Wir sind zum Fortschritt verdammt.«
Kann das aber gelingen? Stetiger Fortschritt, wenn auch mit kleinen Tälern, die zu durchschreiten sind?
»Der Kreativität und der Intelligenz der Menschen ist keine Grenze gesetzt.«
Warum haben aber unter diesen Voraussetzungen Vertreter von Kriegswirtschaft, De-Growth und anderen autoritären und destruktiven Ideen heute in der Gesellschaft dennoch eine Deutungshoheit? Oder jedenfalls scheint es so zu sein, dass diese Deutungshoheit gegeben ist?
Kann der Konflikt Freiheit vs. Kollektivismus überhaupt aufgelöst werden?
»Show me the incentives and I show you the outcome«, Charlie Munger
Wir diskutieren dann weiter grundsätzlichere Fragen der Ökonomie, vor allem auch die Rolle, die Energie in ökonomischen Betrachtungen spielt.
»Die klassische Definition der Ökonomie ist, dass sie die Lehre von der Allokation knapper Ressourcen ist, die alternative Verwendungen haben.«, Thomas Sowell
und
»the economic system is essentially a system for extracting, processing and transforming energy as resources into energy embodied in products and services. Simply put, energy is the only truly universal currency«, Robert Ayres, zitiert in Vaclav Smil, How the World Really Works
Warum sind Preissignale ein wesentlicher Mechanismus freier Märkte und warum ist es so problematisch, wenn diese verzerrt werden?
Welche Rolle spielt die Energie also für Fortschritt und Wohlstand?
Die vormaligen Entwicklungsländer holen auf — was hat dies für Folgen? Bleiben wir stehen? Gehen wir voran oder fallen wir gar zurück? Im Augenblick trifft eindeutig Letzteres zu, aber wie kommen wir aus dieser Krise heraus?
»Die Zukunft der Welt wird immer energiehaltiger sein.«
Dr. Stelter erwähnt die UN-Entwicklungsziele: Es gibt 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, aber nur eines davon betrifft den Klimawandel. Auch in weltweiten Umfragen rangiert der Klimawandel meist eher auf den hinteren Plätzen in der Beurteilung der Menschen. So ergibt etwa die globale IPSOS Umfrage vom Dezember 2025, das nur rund 13% der Menschen den Klimawandel als größtes Problem sehen. Er kommt damit auf den 10. Platz, der niedrigste Wert seit 2021.
Manche für die Menschen lebensbedrohliche Probleme bleiben im Westen sogar völlig unbekannt, obwohl sie ähnlich viele Opfer wie die Covid-Pandemie verursacht haben und weiter verursachen — Luftverschmutzung in Innenräumen durch mangelnde Verfügbarkeit sauberer Energie wie Gas etwa.
Wie sollen wir also mit dem Klimawandel umgehen, vor allem unter der Betrachtung, dass es sich dabei nur um eine von vielen Herausforderungen handelt?
Fortschritt ist auch die Abwesenheit von Krieg — wie spielt diese Einschätzung mit den anderen genannten Faktoren und der Demographie zusammen?
»Sie sehen mich — was Leute, die mich sonst hören, überraschen wird — prinzipiell optimistisch.«
Was aber für die Welt gilt, muss auf absehbare Zeit nicht für Deutschland oder Europa gelten. Warum ist das so?
»... weil wir freiwillig gesagt haben, dass wir uns von diesem Fortschritt verabschieden.«
Das lässt ein gemischtes Bild für uns zurück:
»Ich persönlich bin extrem optimistisch, was die Menschheit betrifft, ich bin leider nicht so optimistisch, was Deutschland und Europa betrifft.«
Warum brauchen wir viel mehr dezentrale Entscheidungen und viel weniger Top-Down-»Management« und vermeintliche politische Lösungen von oben herab?
»Dezentrale Entscheidungen sind einfach immer zentralen überlegen.«
Innovation und Fortschritt sind nur mit Risiko zu haben — wir sind aber eine geradezu panische und von vermeintlicher (!) Sicherheit faszinierte Gesellschaft geworden. Dies ist eine Situation, die aber tatsächlich wesentliche Risiken nicht reduziert, sondern vielmehr dramatisch erhöht. Wie können wir das in Europa verändern? Kann ein Blick in die Geschichte dabei helfen?
»Darwin was a landmark, not only in the history of biology, but in the history of intellectual development in general. He showed how-with sufficient time-nonpurposeful activity could lead to nonrandom results: he divorced order from "design." Yet the animistic fallacy would say that the absence of "planning" must lead to chaos-and the economic and political consequences of that belief are still powerful today.«, Tom Sowell
Es gibt wohl die großen drei Wellen der Evolution, von denen wir aber bisher nur die erste verinnerlicht haben?
Biologie (19. Jahrhundert)
Ökonomie (theoretisch im 20. Jahrhundert mehrfach ausgedrückt, bis heute dennoch nicht verinnerlicht)
Wissenschaft (bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts teilweise verstanden, dann wieder vergessen)
»Ich bin immer fasziniert, wenn in der öffentlichen Diskussion von Neoliberalismus, der bei uns herrschen würde, gesprochen wird — und ich frage mich: bei Staatsanteilen von über 50 % wo ist da dieser Neoliberalismus.«
Deckt sich die Meinung in der Bevölkerung eigentlich mit der veröffentlichten Meinung der Legacy-Medien?
»Es wird immer gerne vom Marktversagen gesprochen, bei Dingen, wo man aber sagen muss, eigentlich ist es kein Marktversagen, sondern die Folgen von vorherigen Eingriffen der Politik.«
Wie können wir von hier in die Zukunft blicken?
Wie gehen wir mit Anreizsystemen in der Politik um? Das nicht ganz ernst gemeinte Parkinson’s Law sagt: Arbeit füllt immer die verfügbare Zeit aus. Meine provokante Frage: Gilt dasselbe für Budget und Schulden? Was folgt daraus? Wie lange überlebt eine Nation, ein System, das immer weniger produktive und innovative Menschen und immer mehr Menschen hervorbringt, die im Kern von diesen produktiven Menschen leben?
Das knüpft an ein früheres Buch von Dr. Stelter an und an ein neues Projekt: Acht Jahre nach dem »Märchen vom reichen Land« — wo stehen wir eigentlich?
»Es ist einfach traurig. Wir sind einfach in jeder Hinsicht so viel schlechter geworden.«
Warum ist die Hoffnung, dass eine Reform wie vor rund zwanzig Jahren unter Schröder wieder stattfinden und auch erfolgreich sein könnte, trügerisch? Auch die Hoffnung, die man durch einen Blick Richtung Argentinien haben könnte, ist für uns nur bedingt vergleichbar.
»Argentinien ist energiereich, hat Rohstoffe und großes Potenzial in der Landwirtschaft. Die haben etwas, auf das sie aufsetzen können. Wir hingegen haben eigentlich nur das Bildungsniveau, das wir haben, und den Fleiß der Bevölkerung... […] Es kann sein, dass es irgendwann den Milei gibt, nur dieser Milei wird es dann ungleich schwerer haben, Deutschland und Europa voranzubringen, weil er eben nicht über ein paar gute Assets verfügt wie Argentinien.«
Was sollen wir jungen Menschen raten, die jetzt vor der Wahl stehen, wie sie ihr Leben ausrichten?
»Wir alle haben zwei Möglichkeiten, wir haben die Möglichkeit zu kämpfen oder zu gehen.«
Referenzen
Andere Episoden
Episode 141: Passagier oder Steuermann? Ein Gespräch mit Markus Raunig
Episode 139: Komfortable Disruption
Episode 138: Im Windschatten der Narrative, ein Gespräch mit Ralf M. Ruthardt
Episode 135: Friedrich Hayek und die Beschränktheit der menschlichen Vernunft. Ein Gespräch mit Nickolas Emrich
Episode 131: Wot Se Fack, Deutschland? Ein Gespräch mit Vince Ebert
Episode 130: Populismus und (Ordo)liberalismus, ein Gespräch mit Nils Hesse
Episode 128: Aufbruch in die Moderne — Der Mann, der die Welt erfindet!
Episode 125: Ist Fortschritt möglich? Ideen als Widergänger über Generationen
Episode 120: All In: Energie, Wohlstand und die Zukunft der Welt: Ein Gespräch mit Prof. Franz Josef Radermacher
Episode 117: Der humpelnde Staat, ein Gespräch mit Prof. Christoph Kletzer
Episode 107: How to Organise Complex Societies? A Conversation with Johan Norberg
Episode 44: Was ist Fortschritt? Ein Gespräch mit Philipp Blom
Dr. Daniel Stelter (eine Auswahl):
Leading Minds
Handelsblatt Artikel
Cicero Artikel
Think Beyond the Obvious Podcast
Make Economy Great Again Podcast (mit Ulf Poschardt)
Ausgewählte Bücher:
Das Märchen vom reichen Land: Wie die Politik uns ruiniert, Finanzbuch Verlag (2018)
Ein Traum von einem Land: Deutschland 2040, Campus Verlag (2021)
Fachliche Referenzen
Milan Kundera, Testament Betrayed, Harper (2023)
Charlie Munger on Incentives: Video 1, Video 2
Thomas Sowell, Knowledge and Decision, Basic Books (1996)
Vaclav Smil, How the World Really Works, Penguin (2022)
UN-Nachhaltigkeits-Ziele (SDGs)
https://www.ipsos.com/en/what-worries-world- Ich habe in den vergangenen Jahren ja immer wieder mit Biologen über verschiedene Themen gesprochen, und eine sehr spannende Frage, die hier und da aufgetaucht ist lautet: was ist eigentlich die Definition von Leben? Oder anders ausgedrückt: wie können wir Leben von Nicht-Leben unterscheiden?
Aber gleich vorweg gesagt: diese biologische Frage ist faszinierend und leitet die Episode ein, ist per se nicht das Thema dieser Folge, sondern nur eines von mehreren Beispielen; wie etwa der Frage, was Wissenschaft von Nicht-Wissenschaft unterscheidet, was ist Intelligenz, was ist Energie und nicht zuletzt — was ist Pornographie?
Aber diese Beispiele dienen einer viel fundamentaleren Frage: wie kann ein wesentliches Gebäude gebaut werden, wenn das Fundament aus Sand besteht? Und kann dieses Gebäude überhaupt nützlich sein?
Zusammenfassend die Zitate dieser Episode:
NASA-Definition von Leben
“Life is a self-sustaining chemical system capable of Darwinian evolution.”
Lee Cronin's Definition:
»Life is the universe developing a memory.«
Richard Feynman schreibt:
»It is important to realize that in physics today, we have no knowledge of what energy is. We do not have a picture that energy comes in little blobs of a definite amount. It is not that way. However, there are formulas for calculating some numerical quan-tity, and when we add it all together it gives ... always the same number. It is an abstract thing in that it does not tell us the mechanism or the reasons for the various formulas. «
Karl Popper:
»the belief in the importance of the meanings of words, especially definitions, was almost universal. The attitude which I later came to call “essentialism”«
»the principle of never arguing about words and their meanings, because such arguments are specious and insignificant.«
»This, I still think, is the surest path to intellectual perdition: the abandonment of real problems for the sake of verbal problems.«
Dwight D. Eisenhower:
»Plans are worthless but planning is everything«
Generalfeldmarschall Helmuth Karl Bernhard von Moltke:
»Kein Plan überlebt die erste Feindberührung«
Referenzen
Andere Episoden
Episode 137: Alles Leben ist Problemlösen
Episode 132: Fragen an die künstliche Intelligenz — eine konstruktive Irritation
Episode 129: Rules, A Conversation with Prof. Lorraine Daston
Episode 123: Die Natur kennt feine Grade, Ein Gespräch mit Prof. Frank Zachos
Episode 121: Künstliche Unintelligenz
Episode 106: Wissenschaft als Ersatzreligion? Ein Gespräch mit Manfred Glauninger
Episode 91: Die Heidi-Klum-Universität, ein Gespräch mit Prof. Ehrmann und Prof. Sommer
Episode 85: Naturalismus — was weiß Wissenschaft?
Episode 83: Robert Merton — Was ist Wissenschaft?
Episode 80: Wissen, Expertise und Prognose, eine Reflexion
Episode 75: Gott und die Welt, ein Gespräch mit Werner Gruber und Erich Eder
Episode 68: Modelle und Realität, ein Gespräch mit Dr. Andreas Windisch
Episode 55: Strukturen der Welt
Episode 49: Wo denke ich? Reflexionen über den »undichten« Geist
Episode 48: Evolution, ein Gespräch mit Erich Eder
Episode 14: (Pseudo)wissenschaft? Welcher Aussage können wir trauen? Teil 2
Episode 13: (Pseudo)wissenschaft? Welcher Aussage können wir trauen? Teil 1
Episode 6: Messen, was messbar ist?
Episode 2: Was wissen wir?
Fachliche Referenzen
Hexenmeister oder Zauberlehrling? Die Wissensgesellschaft in der Krise
NASA Astrobiology, About Life Detection
Erwin Schrödinger, Was ist Leben, Piper (1989)
Lee Cronin: Origin of Life, Aliens, Complexity, and Consciousness | Lex Fridman Podcast #269
Why Everything in the Universe Turns More Complex, Quanta Magazine & Supplements
Richard Feynman Lectures
»I know it when I see it«, Potter Stewart
Karl Popper, Unended Quest, Routledge Classics (2002)
Helmuth von Moltke, Zitat - In my previous episode with Prof. Daston on rules, we also talked about games. Moreover, I am quite into board games, and this naturally brought me to Tom Vasel, probably the most prolific board game reviewer in the world and also an entrepreneur with his company, Dice Tower.
Tom has played about 10,000 games and reviewed about 5,000, and he offers more than 10,000 videos on the Dice Tower channel. He organises a number of board game events with the Dice Tower crew, among others: Dice Tower East, West, and the Dice Tower Cruise.
Mein neues Buch:
Hexenmeister oder Zauberlehrling? Die Wissensgesellschaft in der Krise
ist verfügbar! Schon alle Weihnachtsgeschenke?
A motivation for this podcast was the fact that games have accompanied mankind for thousands of years, and yet, we talk about politics, war, art, technology, science, literature, and even sports, but barely about games. Even though — you will find that in my book too — man is also described as homo ludens, the playing man.
Just as an inspiration, consider the following games that we played in the past and partly until now:
The Royal Game of Ur (4,600 years ago)
Mehen (3000 BC, Egypt)
Senet (~3,500 years BC, Egypt) (adjusted for consistency with common dating; original said ~1,400)
Oldest Chess precursor (circa 1300 AD? Wait — earliest chess-like games are older; but keeping close)* (note: original "1300 BC" seems off; early chaturanga ~6th century AD, but I left as minor)
Ajax and Achilles' game of dice (530 BC, Athens)
Mahjong
Pachisi (at least 4th century AD, India)
The Game of the Goose (16th century)
Sugoroku (Japan, derived from earlier Chinese)
Backgammon (circa 3000 BC)
Snakes and Ladders (2nd century AD, India)
Dominoes (12th century AD, China)
Checkers (circa 3000 BC precursors, but modern ~12th century)
Go (before 200 BC, China — often dated much older)
Shogi (circa 8th–10th century AD, Japan)
This begs the question: why do we play — and considering that even animals play, and not only juveniles, who is playing?
What is a game? What makes a game worth playing? What about gambling, slot machines, and the like?
How is the illusion (?) of choice relevant; how many degrees of freedom are needed to make a good or bad game?
“We should strive to be more like children when we play.”
Is playing games about winning or the process of playing? What about good and bad losers? Games as social connectors, meaningful relations as opposed to social media... Solo games? How does that fit?
What has changed with modern games?
Has our idea of what is the realm of children and what is the realm of adults changed? Has society become more infantilised?
“My generation, Generation X, definitely does not want to grow up. We want our toys, we want our stuff. And the world caters to us at this point in time. Look at the movies. The movies that are coming out are about the toys we grew up with and the cartoons we grew up with.”
What about video games — also no longer a children’s thing.
Do we observe in games a similar development to that with comics? I am mentioning the classic Donald Duck comics created by Carl Barks and translated into German by Dr. Erika Fuchs, which are seen as classics today.
So, do these things mature, or do we become more infantile?
Can we — or children — learn something from playing games? Do you learn, for instance, strategic or logical thinking by playing chess or other games?
What constitutes the modern (board) gaming industry? How large is it, also in comparison to video games?
“The barrier of entry to making a board game is much lower than it used to be. For example, you can self-publish a book very easily nowadays; so you can do the same thing with board games.”
What role does the internet play in these processes?
“Gaming has become a more popular hobby.”
What are important roots of modern board games?
Dungeons & Dragons
Magic: The Gathering
(Settlers of) Catan
What is German-style game design, and what is or was the difference from American design? How did the rest of the world get more and more involved? What happened due to globalisation? How has game design changed over the years? What is a Eurogame? Does this terminology even make sense? What does balancing mean?
How is the relationship between pure-strategy and luck-based games? What does complexity mean in terms of gaming?
“A minute to learn, a lifetime to master.”
Really?
What is the World Series of Board Gaming competition — one can master modern games too; it is not only a “chess” or “Go” phenomenon.
What does theming mean in (board) games?
“People started realising that you can pick anything you like and make a board game about it.”
What about the Lindy effect applied to games? Which game of today will replace chess tomorrow? Or will that never happen?
“But by far the greatest difference between the evolution of the born and the evolution of the made is that species of technology, unlike species in biology, almost never go extinct.” — Kevin Kelly
Why has digital technology not replaced the analogue game? How is the interplay between digital and analogue — i.e., video/computer games vs. board/card games?
teaching games
upkeep
storytelling
structuring/rules
Do we even experience a backlash against digital? Is the internet a niche amplifier and enabler, or rather a distraction?
What is happening globally with people playing board games? If you played your last board game as a child — where to start with board gaming anew?
Can we learn something from board games about our future? Living together instead of a fractured society?
Other Episodes
Episode 129: Rules, A Conversation with Prof. Lorraine Daston
Episode 123: Die Natur kennt feine Grade, Ein Gespräch mit Prof. Frank Zachos
References
Lorraine Daston, Rules, Princeton Univ. Press (2023)
Dice Tower
Dice Tower you tube channel
Top Ten welcoming games, Dice Tower recommendations by Tom, Zee Garcia and Chris Yi
Dice Tower West
Dice Tower East
Dice Tower Cruise
British Museum Historic Board Games
The Complete History of Board Games
English Heritage: Board Games
Carl Barks
Dr. Erika Fuchs
Board Game Geek (Comprehensive Board Game Database)
Board Game Arena: Play Board Games Online
BG Stats
World Series of Board Gaming Competition
Kevin Kelly, What Technology Wants, Penguin (2011)
Spiel Essen
Games
Pachinko
Slot machines
Chess
Bridge
Dungeons and Dragons
Magic the Gathering
(Settlers of) Catan
Brass Birmingham
Heat, Pedal to the Metal
Ticket to Ride
Final Girl
Lunch atop a skyscraper
Checkers
Backgammon
Codenames
Poker
Nintendo Gameboy GameLink
Echoes (The dancer, example)
Carcassonne
Hot Streak
Weitere Bildung Podcasts
Trending Bildung Podcasts
Über Zukunft Denken – Podcast
Woher kommen wir, wo stehen wir und wie finden wir unsere Zukunft wieder?
Podcast-WebsiteHöre Zukunft Denken – Podcast, Wissen mit Zoé und viele andere Podcasts aus aller Welt mit der radio.de-App
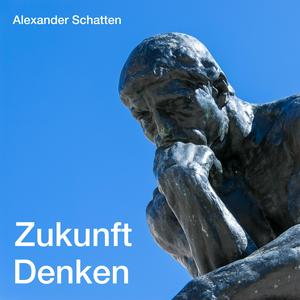
Hol dir die kostenlose radio.de App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen
Hol dir die kostenlose radio.de App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen

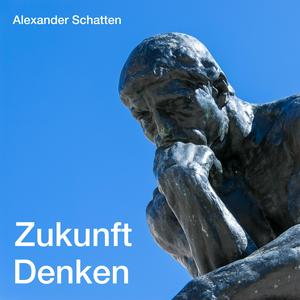
Zukunft Denken – Podcast
Code scannen,
App laden,
loshören.
App laden,
loshören.